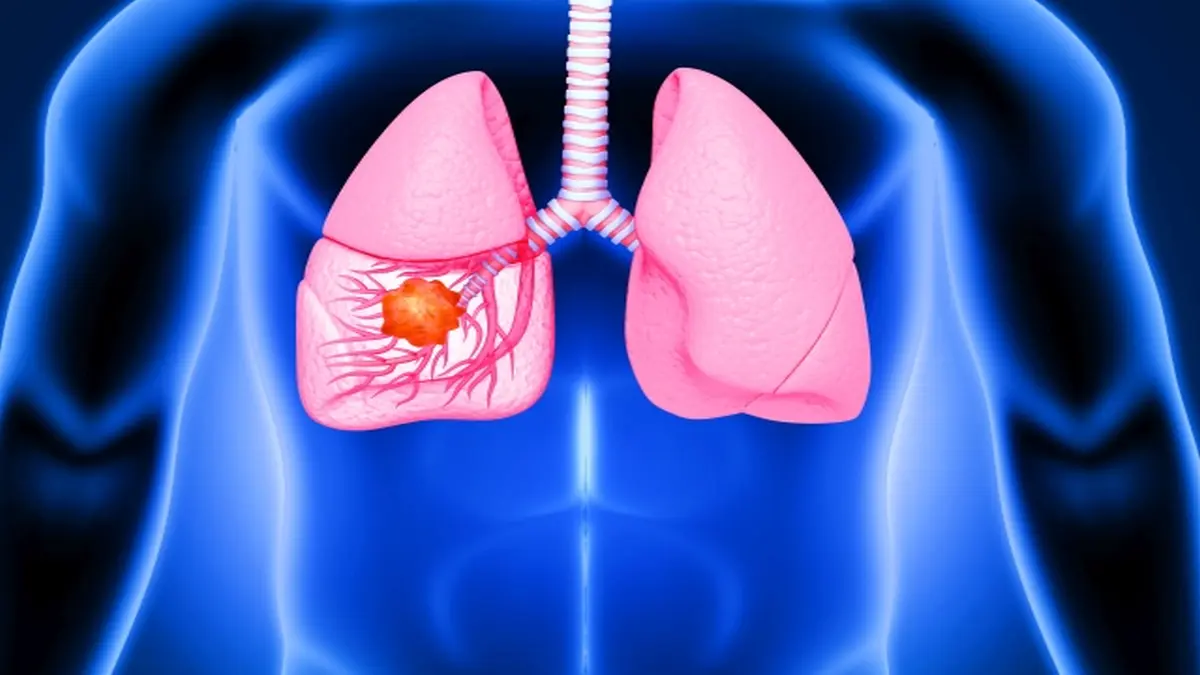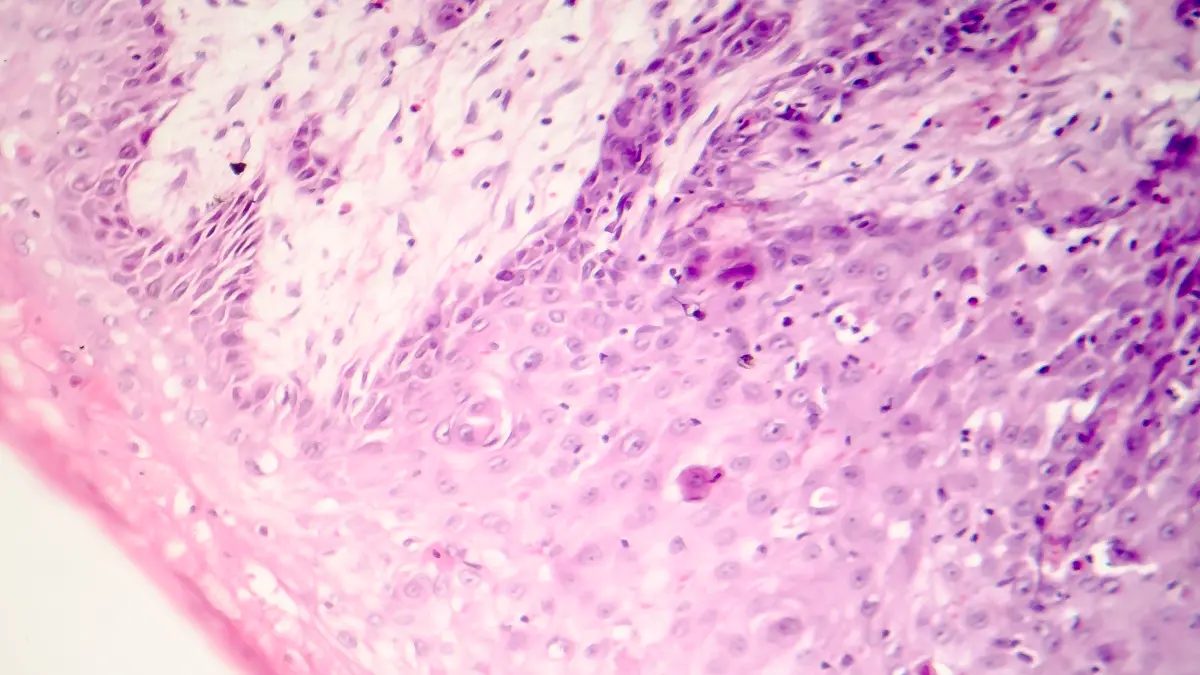Das Lungenkarzinom zählt weltweit zu den häufigsten und tödlichsten malignen Erkrankungen [1]. Trotz erheblicher Fortschritte in der Diagnostik und Therapie bleibt die Prognose für viele Patient:innen mit Lungenkarzinom ungünstig, insbesondere wenn die Diagnose erst in einem fortgeschrittenen oder metastasierten Tumorstadium erfolgt. Eine frühzeitige und präzise Erkennung der Erkrankung, sowie ihrer molekularen Charakteristika ist daher essenziell für die Wahl einer zielgerichteten, personalisierten Therapie und hat unmittelbaren Einfluss auf den Krankheitsverlauf.
Traditionell erfolgt die Diagnosesicherung des Lungenkarzinoms durch eine Gewebebiopsie, bei der Tumormaterial invasiv entnommen und histologisch sowie molekularpathologisch analysiert wird. Diese Methode gilt zwar als Goldstandard, ist jedoch mit interventionellen Risiken verbunden, kann nur begrenzt wiederholt werden und liefert bei tumorheterogenen Prozessen nicht immer ein repräsentatives Bild [2, 3]. Zudem ist sie nicht bei allen Patient:innen durchführbar, insbesondere bei solchen mit reduziertem Allgemeinzustand oder schweren Begleiterkrankungen kann die Invasivität der Biopsie eine erhebliche Einschränkung darstellen, so dass alternative, weniger belastende diagnostische Verfahren erforderlich sind.
In den letzten Jahren hat sich die sogenannte Liquid Biopsy als vielversprechende, minimalinvasive Ergänzung zur klassischen Gewebebiopsie etabliert. In ausgewählten Fällen (z. B. zur Detektion von Resistenzmutationen) kann sie sogar eine Gewebebiopsie ersetzen. Im Rahmen einer Liquid Biopsy werden vom Tumor freigesetzte Biomoleküle wie zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) oder Tumor-RNA (z. B. microRNA, miRNA), zirkulierende Tumorzellen (CTCs) oder extrazelluläre Vesikel (EVs) aus Körperflüssigkeiten – in der Regel Blut – analysiert. Diese Form der Diagnostik erlaubt eine wiederholbare, dynamische Erfassung des Tumorgeschehens, insbesondere im Hinblick auf Therapieansprechen, Resistenzentwicklung und Tumorheterogenität [4].
Unter den genannten Biomolekülen rücken EVs zunehmend in den Fokus der Forschung, da sie eine aktive Rolle in der interzellulären Kommunikation einnehmen und ein reichhaltiges molekulares Profil aufweisen. Sie gelten als vielversprechende Kandidaten für die nichtinvasive Tumordiagnostik und das Krankheitsmonitoring – insbesondere beim Lungenkarzinom [5]. EVs sind kleine, membranumhüllte Partikel, die von nahezu allen lebenden Zellen, inklusive Tumorzellen, aktiv freigesetzt werden. Sie transportieren biologisch relevante Moleküle – darunter Proteine, Lipide sowie DNA und verschiedene RNA-Spezies – von der Ursprungs – zelle zu Zielzellen. Je nach Entstehungsmechanismus und Größe unterscheidet man zwei Hauptklassen: kleine extrazelluläre Vesikel (small EVs, sEVs, ehemals Exosomen) mit einem Durchmesser von bis zu 200 nm sowie größere Vesikel (large EVs, IEVs oder Mikrovesikel) mit einem Durchmesser über 200 nm [6]. Während sEVs intrazellulär durch das Einschnüren endosomaler Membranen entstehen, werden IEVs durch direkte Abschnürung von der Plasmamembran gebildet [7].
Im Vergleich zu ctDNA und CTCs bieten EVs mehrere diagnostisch relevante Vorteile: Ihre membranöse Hülle schützt den molekularen Inhalt vor enzymatischem Abbau, was zu einer erhöhten Stabilität führt [8, 9]. Zudem enthalten sie neben DNA auch intakte RNA-Moleküle und Proteine, was ein umfassenderes molekulares Profiling ermöglicht. Darüber hinaus zirkulieren sie im Blut in deutlich höherer Konzentration (ca. 1010 EVs pro ml Blutplasma; [10]) als ctDNA [11, 12] und CTCs [13–15], was ihre Detektion erleichtert. Ein besonderer diagnostischer Vorteil liegt in ihrer Fähigkeit, die molekulare Heterogenität des Tumors widerzuspiegeln [2, 16]. Während ctDNA oft nur Einzelmutationen abbildet und CTCs selten detektiert werden, liefern EVs eine Art „Momentaufnahme“ des Tumors inklusive Subklon- Strukturen und Signaturen des Tumormikromilieus.