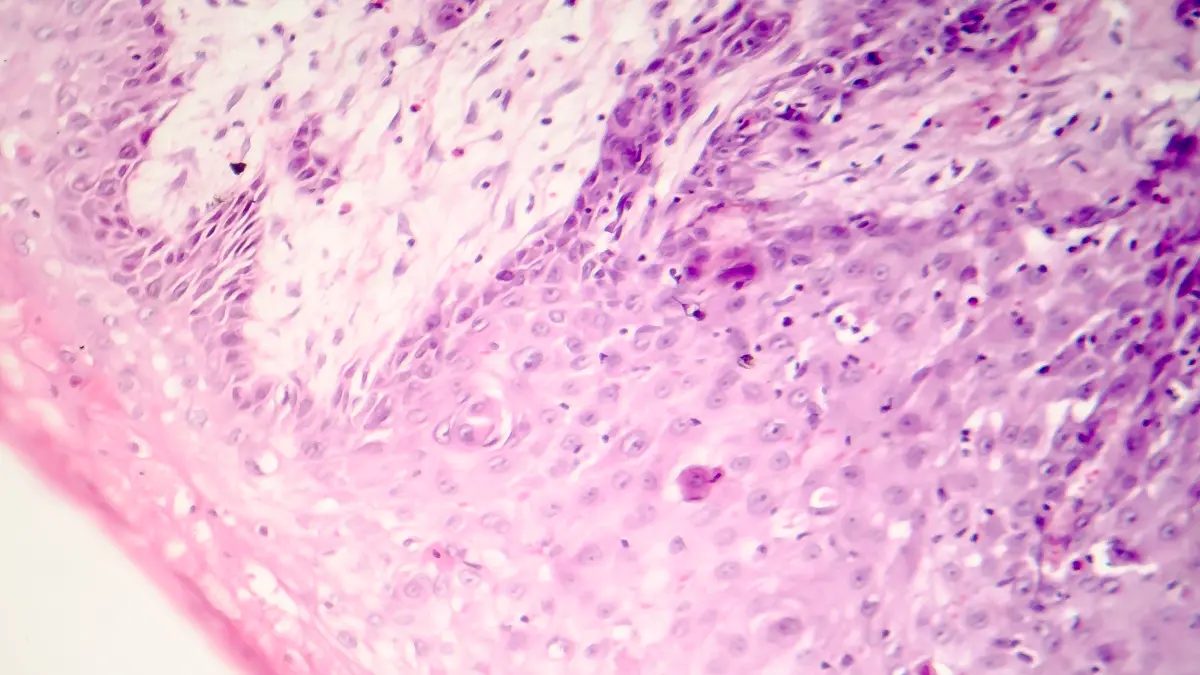Obwohl das familiäre Prostatakarzinom (PCa) einen zentralen Schwerpunkt der urologischen Forschung darstellt, bleiben einige klinische und genetische Fragen bislang unbeantwortet. In der klinischen Praxis ergeben sich dadurch häufig Unsicherheiten in Bezug auf die genaue Definition, diagnostische Konsequenzen und genetische Testung: Wie kann das Risiko einer PCa-Erkrankung für gesunde Männer mit positiver Familienanamnese eingeschätzt werden? Welche diagnos- tischen Konsequenzen ergeben sich bei bereits bekannter genetischer Prädisposition? Dieser Beitrag zielt darauf ab, klare Definitionen aufzuzeigen, die Relevanz familiärer und genetischer Risikofaktoren für das PCa praxisnah darzustellen, epidemiologische Daten zu beleuchten sowie konkrete Handlungsempfehlungen auf Basis aktueller Leitlinien für die Klinik abzuleiten.
Mit 65.820 Neuerkrankungen im Jahr 2020 stellt das Prostatakarzinom (PCa) die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland dar [1]. Die Inzidenz nimmt insbesondere mit dem Lebensalter deutlich zu: Während lediglich 0,3 % aller PCa-Neuerkrankungen bei Männern im Alter von 35 bis 44 Jahren diagnostiziert werden, tritt nahezu die Hälfte der PCa-Neuerkrankungen im Altersbereich zwischen 65 und 74 Jahren auf (▶ Abb. 1). Neben dem höheren Lebensalter gilt auch die ethnische Zugehörigkeit als gesicherter Risikofaktor für die Entwicklung eines PCa: Männer mit afrikanischer oder afrikanisch-karibischer Abstammung erkranken häufiger und meist in jüngerem Alter als Männer europäischer Herkunft – zudem weisen sie häufiger einen aggressiveren Krankheitsverlauf auf [2].
Ein weiterer gesicherter Risikofaktor ist die familiäre Häufung von PCa. Bei der Erhebung der Familienanamnese ist dabei eine klare Unterscheidung zwischen „familiärer Häufung“ und „positiver Familienanamnese“ essenziell. Auf Grundlage dieser Anamnese sollte der betroffene Patient anschließend einer der drei Kategorien – sporadisches, familiäres oder hereditäres PCa – zugeordnet werden.