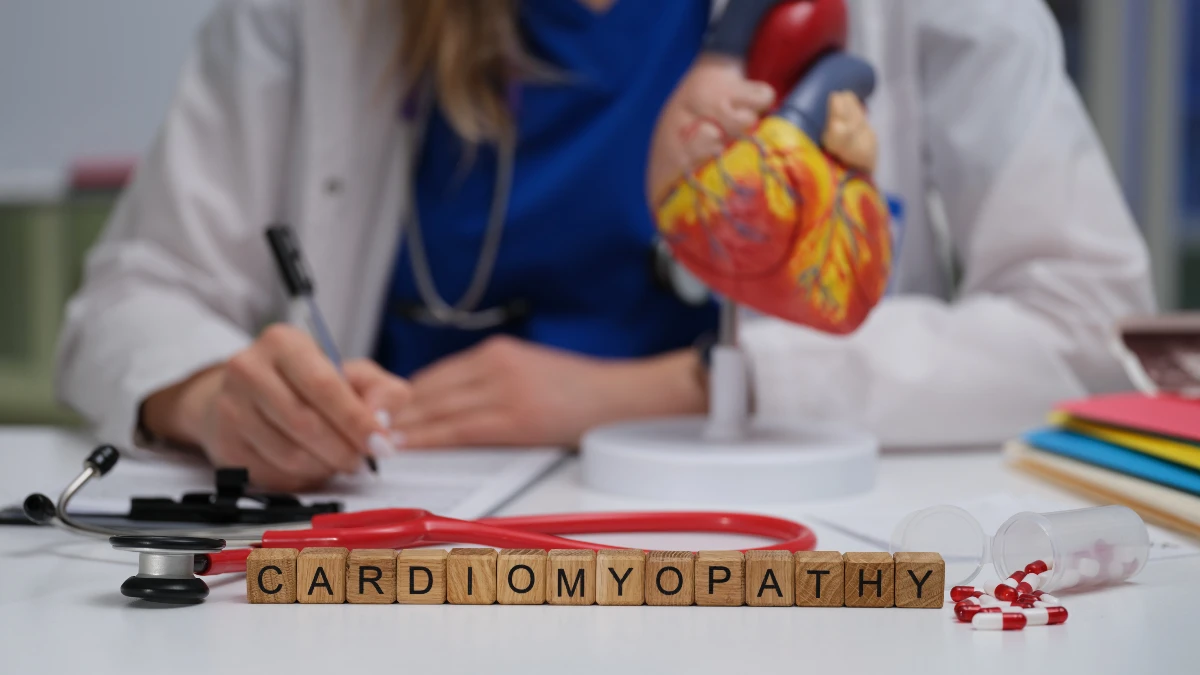„Als Mitglied der ärztlichen Profession gelobe ich feierlich, (…) Ich werde auf meine eigene Gesundheit, mein Wohlergehen und meine Fähigkeiten achten, um eine Behandlung auf höchstem Niveau leisten zu können. (…) Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre“ [1]. Obwohl dieser Passus 2017 in das Genfer Gelöbnis aufgenommen wurde, scheint die Umsetzung von ausreichender „Selbstfürsorge“ für viele Ärztinnen und Ärzte immer noch schwer, häufig auch in Ermangelung eines entsprechenden Problembewusstseins.
Gleichzeitig problematisiert die Bundesärztekammer in einer 2024 veröffentlichten Statistik, dass die Zahl der Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand bereits über 100.000 von insgesamt ca. 568.000 betrage, und eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu befürchten sei, da schon 2023 ca. 23 % der Kolleginnen und Kollegen 60 Jahre oder älter gewesen seien. Der Trend zu familienfreundlichen Arbeitszeiten und die Vorbereitung auf eine zunehmend alternde Gesellschaft könne so nicht vollzogen werden [2], was als alarmierende Aussage gesehen werden kann.
Umso dringlicher erscheint es, zu überlegen, wie die Resilienz des medizinischen Personals ganz allgemein und von Ärztinnen und Ärzten im Besonderen künftig gestärkt werden kann.
Definitionen von Resilienz und Maßnahmen
„Resilienz“ ist uneinheitlich definiert und auch als Forschungskonstrukt nicht einheitlich verbreitet. In der ursprünglichen Bedeutung bezieht sich „Resilienz“ schlichtweg auf die „Widerstandskraft“ eines Materials. Welter-Enderlin formuliert, dass kein Mensch unverwundbar oder immun gegenüber dem Schicksal sei. Unter Resilienz werde vielmehr die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen [3]. Kalisch vom Leibniz-Institut für Resilienz definiert Resilienz als dynamische Anpassungsleistung in Bezug auf Stressoren. Trotz, während oder infolge von physischen oder psychologischen Schwierigkeiten wird Gesundheit aufrecht erhalten oder wiederhergestellt [4]. Zu Recht wird das Konzept „Resilienz“ lediglich auf Fähigkeiten eines Individuums bezogen verschiedentlich kritisiert, da Individuen Teil sozialer Systeme sind, welche unterschiedlich belastbar sind und die Adaptionsfähigkeiten einzelner unterschiedlich unterstützen können [5].
Die Assoziation der amerikanischen Psychiater (APA) benannte nach 9/11 die folgenden Maßnahmen zur allgemeinen Resilienzstärkung [6]:
- Soziale Kontakte schließen.
- Probleme nicht als unüberwindbar ansehen.
- Veränderungen als Teil des Lebens akzeptieren
- Ziele anstreben.
- Entschlossen handeln.
- Auf Wachstumschancen achten.
- Positives Selbstbild aufbauen.
- Zukunft im Auge behalten.
- Optimistisch bleiben.
- Für sich selbst sorgen.
Psychische Gesundheit von Ärzten in Deutschland
Insgesamt hat sich die Datenlage zum Thema Ärztegesundheit in Deutschland“ in den letzten 20 Jahren etwas verbessert, wenngleich im angloamerikanischen Sprachraum ein Vielfaches an Studien publiziert werden und ein deutlich höheres Problembewusstsein zu bestehen scheint.
In einer Übersichtsarbeit zur psychischen Gesundheit somatisch tätiger Ärztinnen und Ärzte in Deutschland fanden sich Werte für Emotionale Erschöpfung, welche als Kernkomponente von Burnout gesehen werden kann, von 4,2–8,2 % [7]. In weiteren Studien unserer Arbeitsgruppe fanden sich für psychiatrisch tätige Kolleginnen und Kollegen Werte von 12–13 % für Emotionale Erschöpfung [8, 9].
Hinweise für eine leichte depressive Symptomatik zum Untersuchungszeitpunkt fanden sich bei 7,8–9,6 % der somatischen Kolleginnen und Kollegen [6] sowie bei 12,6–14,6 % der psychiatrisch tätigen Kolleginnen und Kollegen [8, 9].
Mit unter anderem dem Ziel die Arbeitsfähigkeit des medizinischen Personals während künftiger Pandemien aufrecht zu erhalten und die Ressourcensteuerung zu verbessern, wurde während der Corona-Krise erstmals die psychische Gesundheit des medizinischen Personals in Deutschland im Rahmen des egePan Unimed Projekts (Entwicklung, Testung und Implementierung von regional adaptiven Versorgungsstrukturen und Prozessen für ein evidenzgeleitetes Pandemiemanagement) in großem Stil mit hohen Fallzahlen untersucht.
Unter den sogenannten VOICE-Studien finden sich verschiedene wichtige Ergebnisse. Unter anderem nahm die Belastung des medizinischen Personals während der Pandemie zu [10, 11]. Darüber hinaus fanden sich bei ca. 20 % der Untersuchten erhöhte Werte für Angst und Depressivität, welche im Zuge der Pandemie zunahmen und im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöht waren.
Als potentiell gesundheitserhaltende Faktoren wurden in diesem Rahmen die erlebte Kohärenz (= Sinnhaftigkeit), die wahrgenommene soziale Unterstützung sowie Optimismus gefunden [12, 13].
Zusammenhang Burnout und Resilienz bei medizinischem Personal
Zunächst ist zu sagen, dass die Wirkung von Resilienzmaßnahmen noch zu wenig erforscht und uneinheitlich hinsichtlich der Ergebnisse ist, um allgemeingültige Empfehlungen zu geben.
West et al. fanden im Rahmen einer Querschnittsbefragung bei Ärztinnen und Ärzten eine größere Resilienz als in der allgemeinen Erwerbsbevölkerung. Dennoch waren die Burnout-Raten selbst bei den widerstandsfähigsten Ärztinnen und Ärzten erheblich. Sie halten die Behebung von Systemproblemen im klinischen Versorgungsumfeld für erforderlich, um Burnout zu reduzieren und das Wohlbefinden der Kolleginnen und Kollegen zu fördern [14]. Auch Nituica et al. schlussfolgern, dass die Entwicklung der Resilienz nicht nur durch die Förderung von individueller Resilienz erfolgen sollte, sondern auch durch Entwicklung der Infrastruktur und eines institutionellen Schutzsystems gegen Burnout bei Gesundheitsdienstleistern [15].
Dies beschreiben auch Kunzler et al. in einer Metaanalyse (n = 44 Studien), welche sich mit der Wirksamkeit von Resilienzmaßnahmen bei medizinischem Personal beschäftigt. Die Autoren schlussfolgern, dass es für Angehörige der Gesundheitsberufe eine sehr geringe Evidenz dafür gebe, dass Resilienztrainings im Vergleich zur Kontrolle zu einem höheren Maß an Resilienz, einem geringeren Maß an Depression, Stress oder Stresswahrnehmung und einem höheren Maß an bestimmten Resilienzfaktoren nach der Intervention führen könnten. Allerdings deuteten die Ergebnisse dennoch auf positive Effekte von Resilienztrainings für medizinisches Personal hin [16].
Das medizinische Personal selbst scheint häufig Maßnahmen zur Stärkung der individuellen Resilienz gegenüber eher kritisch eingestellt zu sein. Dies geht beispielsweise auch aus einer multizentrischen Querschnittsbefragung hervor, in welcher 15.738 Pflegende und 5.312 Medizinerinnen und Mediziner teilnahmen. Es zeigten sich hohe und verbreitete Werte für Burnout unter Klinikern, die mit häufiger Personalfluktuation und Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit verbunden waren. Darüber hinaus mangelt es an Vertrauen in das Management, um Probleme bei der Patientenversorgung zu lösen. Verbesserungen in der Personalausstattung, insbesondere eine ausreichende Besetzung des Pflegepersonals, und des Arbeitsumfelds wurden als wichtiger für psychische Gesundheit und Wohlbefinden als die Einführung von Wellness- und Resilienzprogrammen gesehen [17].
Fallvignette:
Der 53-jährige Dr. B. hatte vor 17 Jahren die Allgemeinarztpraxis des Vaters übernommen. Hatte ihm die Arbeit als Arzt lange große Freude gemacht, war er über die letzten Jahre zunehmend gereizter und zynischer im Umgang mit Mitarbeitenden und Patienten und Patientinnen. Es war immer schwieriger, MFAs zu finden, auch einen Praxispartner hatte er trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden. Fortlaufend bemühte er sich, den vielen Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Dennoch fühlte er sich seit 1–2 Jahren emotional ausgelaugt, teilweise zynisch, deutlich weniger leistungsfähig als früher. Hinzu kamen ausgeprägte Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, ein reduzierter Antrieb und ausgeprägter sozialer Rückzug im Privatleben. Vor allem aus Scham traute er sich nicht, mit befreundeten Kollegen über seine Erschöpfung zu sprechen, hatte er doch früh gelernt, dass seine eigenen Bedürfnisse immer hinten angestellt werden mussten. Sein Vater hatte ihm die Rolle des aufopfernden Arztes vorgelebt und zeitlebens unerbittlich hohe Ansprüche an ihn gestellt. Er befürchtete, von diesem ausgelacht und als „schwach“ bezeichnet zu werden, wenn er mit dem Gedanken spielte, die Sprechstundenzeiten leicht zu reduzieren. Zudem gelang es ihm kaum, Patienten und Patientinnen in Bezug auf die an ihn gestellten Forderungen Grenzen zu setzen, was ihn immer mehr frustrierte. Er fühlte sich für alles verantwortlich, was ihn immer mehr überforderte. Rückmeldungen seitens seiner Partnerin, dass er zu wenig Zeit mit der Familie verbringe, erreichten ihn zwar, er fühlte sich jedoch nicht imstande, der Familie mehr Zeit einzuräumen, das ihn ebenfalls massiv belastete. Erst nach einer eigenen schweren somatischen Erkrankung gestand er sich zu, sich mehr um sich selbst zu kümmern. Er begann eine ambulante Psychotherapie, in der sich unter anderem mit seiner eigenen Biografie, seinen Bedürfnissen, Emotionen und ungünstigen Verhaltensmustern auseinandersetzte. Nach und nach gelang es ihm, sich annähernd genauso gut um sich selbst zu kümmern wie er das Jahrzehntelang für seine Patientinnen und Patienten getan hatte. Dafür musste er an einigen Stellen Irritationen und Konflikte in Kauf nehmen, fühlte sich jedoch zunehmend seinen persönlichen Werten von Verbindung, Akzeptanz und Authentizität näher.
Guille und Sen formulieren in einem Review Folgendes [siehe 18]:
– Solange sich kein Konsens für das umstrittene Konstrukt „Burnout“ abzeichne, solle Depression als ein effektiveres Konstrukt für Studien zum Wohlbefinden von Ärzten genutzt werden
– Verbesserung des Zugangs von Ärztinnen und Ärzten zu Behandlungsmaßnahmen in Bezug auf eigene psychische Erkrankung und Entstigmatisierung derselbigen
– Da Interventionen, die auf Reduzierung von Arbeitszeiten und Arbeitsbelastung abzielten, mittlere bis große Auswirkungen erzielten, sollten diese hinsichtlich Forschung und Umsetzung priorisiert werden
– Dringender Ausbau von Maßnahmen zur Verbesserung des Eltern und Betreuungsurlaubes sowie
des Zugangs zu Kinderbetreuung
– Zwar geringere, jedoch ebenfalls vorhandene Evidenz für Maßnahmen auf der individuellen Ebene wie achtsamkeitsbasierte Stressreduktion und kognitive Verhaltenstherapie Vorschläge zur individuellen Resilienzstärkung von Ärztinnen und Ärzten
– Pflegen von kollegialen wie privaten Beziehungen
– Regelmäßiger kollegialer Austausch, beispielsweise auch im Rahmen von Inter-/Supervision oder Gruppen zur interaktionellen Fallarbeit (IFA) oder Balintgruppen, um emotional belastende Situationen zu reflektieren und zu bewältigen
– Regelmäßiges Praktizieren von Achtsamkeit und/oder Entspannungsverfahren, u. a. auch kurze Einheiten während des Arbeitsalltags
– Einhalten von Pausenzeiten,
– Umsetzung der „Basics“ wie regelmäßig ausreichend Trinken, Essen, Toilettengang
– Individuelle Wege zur Stressbewältigung finden, z. B. regelmäßig Sport treiben, praktizieren von Yoga, Entspannungsverfahren,…
– Üben und Praktizieren von Selbstmitgefühl
– Sich Zugestehen von eigener Verwundbarkeit und Schwäche
– Inanspruchnahme von Psychotherapie bei eigener psychischer Erkrankung, evtl. trotz ausgeprägter Scham im Hinblick auf die eigene Erkrankung.
Literatur:
- Offizielle deutsche Übersetzung der Deklaration von Genf, autorisiert durch den
Weltärztebund. Weltärztebund – Deklaration von Genf – Das ärztliche Gelöbnis;
zugegriffen 09.05.2025 - 2023 – Bundesärztekammer; zugegriffen 05.05.2025 Ärztestatistik 2023 – Update
- Welter-Enderlin, R und Hildenbrand B (Hrsg) Resilienz- Gedeihen trotz widriger
Umstände. Verlag Carl Auer 2012 Heidelberg, S. 18–20. - Kalisch R et al. The resilience framework as a strategy to combat stress-related
disorders. Nature human behaviour 2017; 1(11): 784–90 - Southwick SM et al. Why are some individuals more resilient than others: the role of
social support. World psychiatry 2016 15(1): 77–90 - https://apa.org/topics/resilience
- Braun, M und Beschoner, P Psychische Gesundheit somatisch tätiger ÄrztInnen in
Deutschland. Zeitschrift Ärztliche Psychotherapie 2022; 17: 272–278. - Braun M. et al. Burnout, Depression und Substanzgebrauch bei deutschen Psychiatern
und Nervenärzten. Ergebnisse einer Pilotstudie. Nervenheilkunde 2008, 27: 800–804 - Braun M. et al. Depression, Burnout and Effort-Reward-Imbalance among Psychiatrists.
Letter to the editor. Psychotherapy and Psychosomatic 2010; 79: 326–327 - Morawa et al. Psychosocial burden and working conditions during the COVID-19
pandemic in Germany: The VOICE survey among 3678 health care workers in hospitals,
Journal of Psychosomatic Research 2021,144: 1–10 - Erim et al. Arbeitsplatzbezogenes Belastungserleben und psychische Gesundheit der
Beschäftigten im Gesundheitswesen während der COVID-19-Pandemie: Risiko- und
Schutzfaktoren aus der VOICE Studie Bundesgesundheitsblatt 2024· 67:1248–55 - Schug et al. Social Support and Optimism as Protective Factors for Mental Health among
7765 Healthcare Workers in Germany during the COVID-19 Pandemic: Results of the
VOICE Study. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(7): 3827 - Schmuck et al. Sense of coherence, social support and religiosity as resources for medical
personnel during the COVID 19 pandemic: A web-based survey among 4324 health care
workers within the German Network University Medicine. PLoS ONE 202116(7): 1–18
e0255211 - West CP et al. Resilience and Burnout Among Physicians and the General US Working
Population. JAMA Netw Open 2020; 3(7): e209385 - Nituica C. et al. Factors influencing resilience and burnout among resident physicians – a
National Survey. BMC Med Educ 2021; 21: 514 - Kunzler AM et al. Psychological interventions to foster resilience in healthcare
professionals. Cochrane Database Syst Rev 2020; 7(7): CD012527 - Aiken LH et al. Physician and Nurse Well-Being and Preferred Interventions to Address
Burnout in Hospital Practice: Factors Associated With Turnover, Outcomes, and Patient
Safety. JAMA Health Forum 2023; 4(7): e231809 - Guille C & Sen S. Burnout, Depression, and Diminished Well-Being among Physicians. N
Engl J Med 2024; 391(16): 1519–27
Interessenskonflikte:
M. Braun erklärt, dass bei der Erstellung des Beitrags keine Interessenkonflikte im Sinne der Empfehlungen des International Committee of Medical Journal Editors bestanden.
© mgo fachverlage, all rights reserved
Korrespondenzadresse:
Dr. Maxi Braun
Privatpraxis für Psychotherapie
FÄ für Psychiatrie und Psychotherapie
FÄ für Psychotherapeutische Medizin
Supervisorin (VT), IFA-Gruppen- und Selbsterfahrungsleiterin
(BLAEK anerkannt)
Am Eichet 3
86938 Schondorf
www.drmaxibraun.de
info@drmaxibraun.de
Bilderquelle: © Alliance – stock.adobe.com