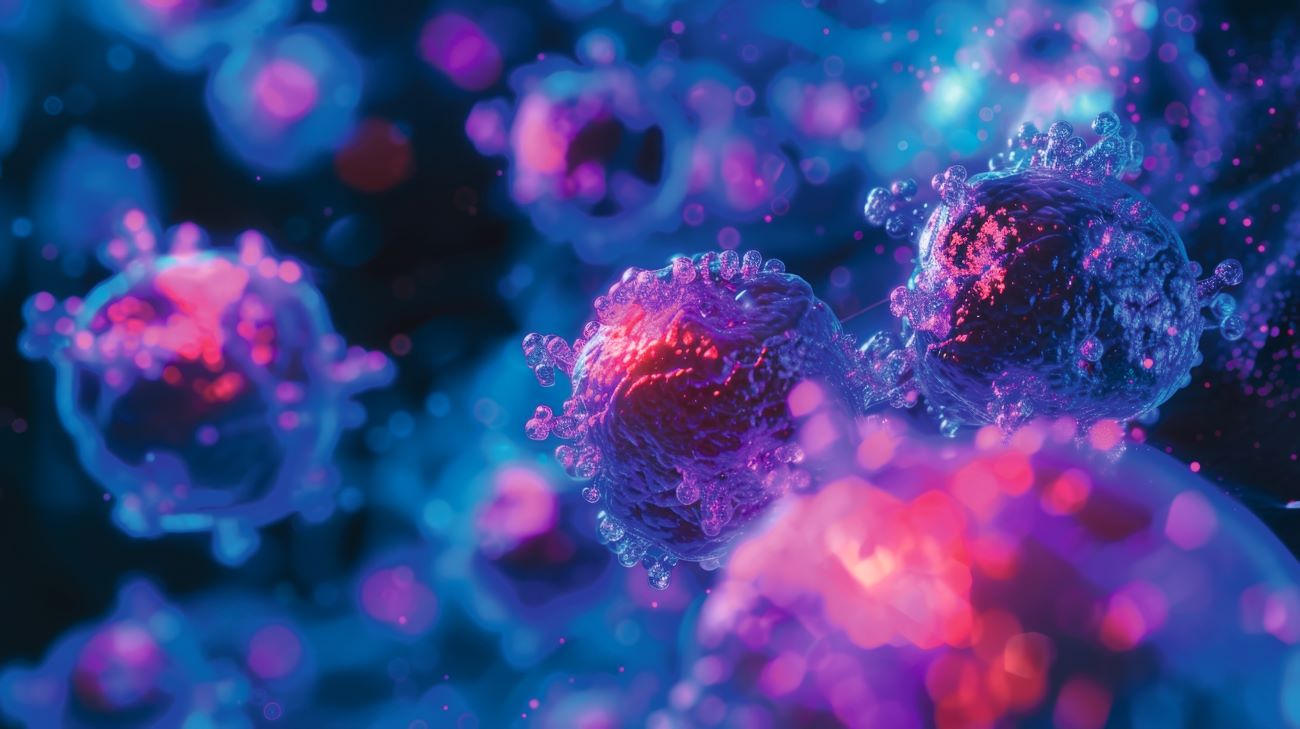In der Rheumatologie rückt die Hämatoinflammation immer mehr in den Fokus. So gibt es Überlappungen zwischen dem myelodysplastischen Syndrom (MDS) und Autoimmunerkrankungen. Wie stellt sich dies aus hämatoonkologischer sowie rheumatologischer Perspektive dar?
Liegt bei rheumatologischen Patientinnen und Patienten eine Zytopenie vor, gilt es dies differenzialdiagnostisch abzuklären, berichtete Prof. Dr. med. Ulrich Germing, Hämatoonkologe aus Düsseldorf. Weisen die Betroffenen ein polyklonales gesundes Kompartiment der hämatopoetischen Stammzellen auf, handelt es sich in der Regel um eine die rheumatologische Erkrankung begleitende Zytopenie, wie z.B. bei systemischem Lupus erythematodes. Zudem können sie auch als Folge einer medikamentöser Therapie auftreten, Stichwort Toxizität.
Zeigt sich jedoch ein klonal erkranktes Kompartiment der hämatopoetischen Stammzellen, so könne die Zytopenie durch eine klonale Stammzellerkrankungen wie beispielsweise einem MDS, einer akuten myeloischen Leukämie (AML) oder einer myeloproliferativen Neoplasie (MPN) bedingt sein, so Germing. Dies könne gegebenenfalls durch die medikamentöse Therapie rheumatologischer Erkrankungen begünstigt werden. „Das entspricht nach der WHO-Klassifikation dann einem post-zytotoxischen MDS“, erläuterte der Experte.
Wenn die Hämatopoese aus dem Gleichgewicht gerät
Was passiert im Knochenmark? Die Entwicklung von normaler, polyklonaler Hämatopoese zu klonaler Hämatopoese von unbestimmtem Potenzial (CHIP), MDS und AML verläuft schrittweise, bedingt durch somatische Mutation. Hieran kann eine Vielzahl von Genen und Pathways beteiligt sein. Von CHIP spricht man, wenn somatische Mutationen in Zellen des Blutes oder des Knochenmarks gefunden werden, aber keine anderen Kriterien für hämatologische Neoplasien erfüllt sind. Die Prävalenz nimmt mit dem Alter zu und liegt bei etwa 10 % der 70- bis 80-Jährigen. Es wird geschätzt, dass in Deutschland etwa 2,75 Millionen Menschen betroffen sind. Pro Jahr entwickelt sich daraus bei 0,5–1 % der Fälle eine hämatologische Neoplasie. Damit liegt die Inzidenz etwa 13-mal höher als bei solchen Neoplasien im Allgemeinen. Wird CHIP bei einem Patienten mit normalem Blutbild zufällig entdeckt, sollte zunächst ein komplettes Blutbild gefolgt von einem Differenzialblutbild drei Monate später gemacht und dann jährlich wiederholt werden.
Empfehlungen für die Diagnostik
Orientierend sollten für die Diagnostik neben einem Blutbild inklusive Erythrozyten-Indizes ein maschinelles Differenzialblutbild zur Quantifizierung der Leukozyten sowie ein manuelles Differenzialblutbild zur morphologischen Beurteilung der Blutzellen erfolgen. „Sind Zellzahlen, Erythrozyten-Indizes und Differenzialblutbild quantitativ und qualitativ normal, liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Stammzellerkrankung vor“, sagte der Hämatoonkologe. Zeigt sich eine Zytopenie, so empfiehlt sich eine hämatologische Diagnostik zur Unterscheidung sekundärer Zytopenien von Stammzellerkrankungen, vor allem einem MDS.
Bei MDS handelt es sich um eine Neoplasie der hämatopoetischen Stammzellen, gekennzeichnet durch Dysplasien von Zellen im Blut und Knochenmark. „Die Patientinnen und Patienten haben ein um rund zwanzig Prozent erhöhtes Risiko eine Leukämie zu entwickeln“, so Germing. Über 60 % der Betroffenen haben chromosomale Aberrationen, über 90 % weisen mindestens eine somatische Mutation auf. Die Lebenserwartung ist meist verkürzt. Als Hauptrisikofaktor für MDS gilt laut dem Experten das Alter, gefolgt von CHIP und Mutagenen. Auch Keimbahnmutationen scheinen eine Rolle zu spielen.
Im Knochenmark zeigen sich apoptopische Figuren, die zur Zytopenie beitragen: Neben Dysplasien treten eine klonale Expansion sowie häufig eine Proliferation auf. Germering berichtete, dass es auf Grund von chromosomaler oder somatischer Expansion bzw. Evolution in den meisten Fällen zu einer Veränderung der Mutationen komme. „Das ist ein kontinuierlicher Prozess“, erklärte er.
Um den Krankheitsverlauf abschätzen zu können, wird das revised international prognostic scoring system for MDS (IPSS-R) angewendet. Auf dieser Basis werden fünf Risikogruppen – von sehr niedrig bis sehr hoch – unterschieden. Noch etwas genauer sei laut Germing der IPSS-M, der breite molekulargenetische Analysen integriert.
Therapie der MDS
Die MDS-Behandlung richtet sich nach dem Risikoprofil der Betroffenen. Ziel ist die Normalisierung des Blutbildes und damit die Wiederherstellung der Lebensqualität. Liegt ein niedriges Risikoprofil vor, sprich es besteht keine Lebensgefahr, die Patientin bzw. der Patient ist zytopen und anämisch, jedoch asymptomatisch, wird das watch and wait-Prinzip empfohlen. Ist die Zytopenie symptomatisch, können Erythropoetin (EPO), Lenalidomid oder Luspatercept eingesetzt werden.
Bei fehlendem klinischen Ansprechen oder Rezidiv kann der Einschluss in eine klinische Studie sinnvoll ein. „Haben wir Hochrisiko-Patienten, bei denen wir wissen, dass sie im Median nur noch ein bis zwei Jahre leben werden, müssen wir die Frage nach dem Allgemeinzustand stellen“, so Germering. Bei schlechtem Allgemeinzustand (AZ) und einem Alter > 65–70 Jahre würde eine palliative Begleitung erfolgen. Sind die Betroffenen jünger (< 65–70 Jahre) und weisen einen guten AZ auf, so könne eine allogene Blutstammzelltransplantation angestrebt werden. „Die beobachtete Heilungsrate liegt hier zwischen vierzig und sechzig Prozent“, berichtete der Experte.
Hämatoinflammation als gemeinsamer Faktor
Eng mit MDS assoziiert ist das VEXAS-Syndrom, das Chamäleon der Rheumatologie. Dabei handelt es sich um eine seltenes autoinflammatorisches Krankheitsbild mit Beteiligung diverser Organsysteme. Ausgelöst wird es im Erwachsenenalter durch eine somatische Mutation des UBA1-Gens. Der Name VEXAS ist ein Akronym aus Vakuolen, Ubiquitin-aktivierendes E1-Enzym, X-chromosomal bedingt, Autoinflammatorisch und Somatisch. Man geht davon aus, dass circa 20 bis 50 % der VEXAS-Betroffenen ein MDS haben bzw. entwickeln, erläuterte Dr. med. Martin Krusche, Rheumatologe aus Hamburg. Sowohl beim VEXAS-Syndrom als auch beim MDS stehe die Hämatoinflammation im Fokus. Die somatische Mutation kann mit einem inflammatorischen Phänotyp einhergehen und zuweilen könne sich daraus ein Teufelskreis ergeben, meinte Krusche.
Aus rheumatologischer Sicht zeigt sich beim MDS über die Hämatoinflammation hinaus zudem eine Immundysregulation. „Die absolute T-Zell-Zahl ist beim MDS erniedrigt und es zeigt sich eine Verschiebung hin zu einer Th-2-Überantwort“, so Krusche. Bereits vor über 30 Jahren wurden Daten zu rheumatologischen Manifestationen bei MDS publiziert, die eine signifikante Assoziation nahelegen. Es stell sich die Frage der Ursache – was Henne und was Ei sei. Eine retrospektive Studie aus Südkorea analysierte die Daten von über 15.000 Patientinnen und Patienten mit rheumatologischen Systemerkrankungen6: In dieser Kohorte wurden 64 MDS-Betroffene identifiziert. Vor allem SLE erwies sich als ein bedeutender Risikofaktor für MDS. Ein niedrigerer Hämoglobinwert zum Zeitpunkt der Diagnose der rheumatologischen Erkrankung war mit der zukünftigen Entwicklung von MDS verbunden. Abschließen lässt sich die Frage der Ursache jedoch noch nicht beantworten. „Bei unklaren Erkrankungsfällen sollte man differenzialdiagnostisch sowohl an MDS als auch an VEXAS denken“, rief Krusche auf. Vor allem bei Patientinnen und Patienten mit einem therapierefraktären Verlauf und hohem Steroidbedarf sollten die Alarmglocken läuten. „Der enge Schulterschluss mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Hämatoonkologie ist sehr wichtig, um die Erkrankung gut behandeln zu können“, schloss Krusche.
Autor: Martha-Luise Storre
Quelle: Wissenschaftliches Symposium „Rheumatologie und Onkologie“ im Rahmen des DGRh am 20. September 2024 in Düsseldorf
Bildquelle:© Justlight – stock.adobe.com