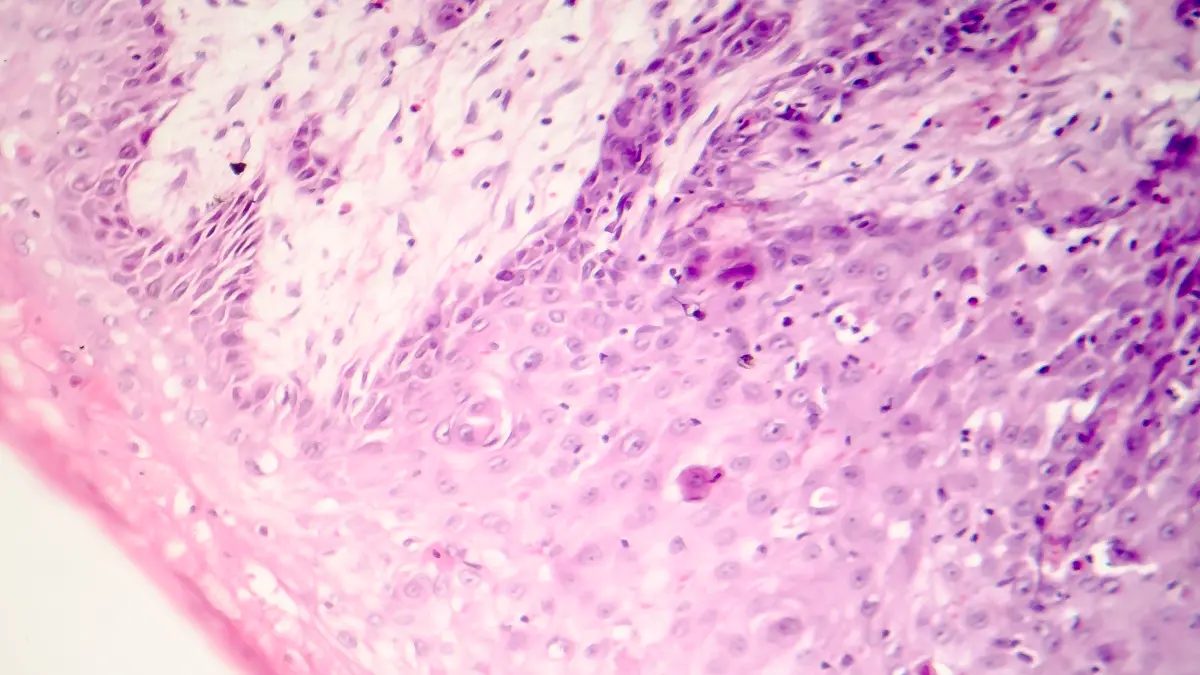Das Prostatakarzinom ist die häufigste Tumorerkrankung bei Männern in Deutschland [1]. Die Rolle familiärer und hereditärer Risikofaktoren rückt dabei zunehmend in den Fokus. Die aktuelle S3-Leitlinie Prostatakarzinom empfiehlt erstmals, Männer mit einem diagnostizierten Prostatakarzinom und Hinweisen auf ein familiäres Tumorrisikosyndrom in einer humangenetischen Sprechstunde vorzustellen und eine Keimbahntestung durchzuführen [2]. Für gesunde Männer mit Anzeichen auf ein Tumorrisikosyndrom wird zusätzlich ein PSA-basiertes Screening ab dem Alter von 45 Jahren empfohlen. Doch wie kann mit den psychosozialen Herausforderungen bei familiärem und hereditärem Risiko umgegangen werden und wie können Ratsuchende adäquat unterstützt werden?
Familiäres und hereditäres Risiko bei Prostatakarzinom
Das Prostatakarzinom zählt zu den Krebserkrankungen mit einem hohen Anteil genetischer Risikofaktoren: Schätzungen zufolge lassen sich bis zu 57 % des Erkrankungsrisikos auf erbliche Komponenten zurückführen [3, 4]. Das relative Erkrankungsrisiko ist bei mindestens einem erkrankten Verwandten 1. Grades bereits 2- bis 3-fach erhöht und steigt mit der Anzahl der betroffenen Familienmitglieder sowie deren früherem Erkrankungsalter [5, 6]. Eine familiäre Häufung von Brustund Ovarialkarzinomen sowie von Darmkrebs im Rahmen eines vorliegenden Lynch-Syndroms sind ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für Prostatakarzinome assoziiert [5].
Ein familiäres Prostatakarzinom liegt vor, wenn eine gehäufte Anzahl von Erkrankungsfällen innerhalb der Familie beobachtet wird, ohne dass identifizierbare genetische Veränderungen nachgewiesen werden können. Bei einem hereditär erhöhten Prostatakarzinomrisiko liegt zusätzlich eine nachgewiesene Keimbahnvariation vor. Keimbahnvariationen wie BRCA1, BRCA2 und HOXB13 gehen mit einem deutlich erhöhten Erkrankungsrisiko einher, So ist das Risiko, bis zum Alter von 65 Jahren an einem Prostatakarzinom zu erkranken, bei BRCA2 beispielsweise 8,6-fach erhöht [7]. Die Keimbahnvariationen BRCA2, ATM und NBN wurden zudem mit aggressiveren Phänotypen und schlechteren klinischen Verläufen assoziiert [8]. Auch genetische Risikomarkervarianten (single nucleotide polymorphisms, SNPs) werden zunehmend zur individuellen Risikoabschätzung herangezogen, insbesondere im Rahmen polygenetischer Risikoscores [9].